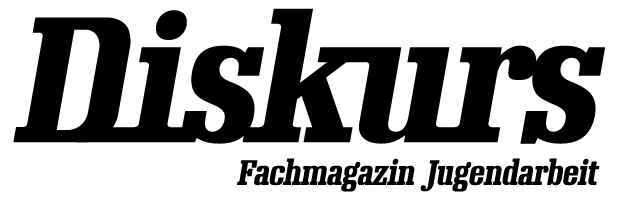„Bei mir beginnt es schon in der Früh, wenn ich den Wecker abdrehe, dass ich dann auch gleich schau, wer mir geschrieben hat und dann da gleich schon antworte. Und dann halt am Weg zur Schule, in der Schule halt dann nicht, weil da haben wir ein Handyverbot, das ist auch verständlich und ich finde es eigentlich auch gut. Und dann nach der Schule, also in der Freizeit schaut man dann wieder und am Abend. In der Nacht schalte ich es auch nicht aus.“
Julia, 14 Jahre
Julia ist eine typische Vertreterin der Generation, der so genannten Digital Natives (Prensky, 2001), jener jungen Menschen, die bereits mit digitalen Medien- und Informationstechnologien aufgewachsen sind.
Dass dieser Begriff zu angesichts der Heterogenität der Gruppe der jugendlichen NutzerInnen, was ihre Kompetenzen, Präferenzen und Nutzungsweisen betrifft, zu kurz greift, unterstreichen aktuellere Befunde (Hugger, 2014, S. 21). Treffender als das Narrativ der „Digital Natives“ erscheint der Begriff der Mediengeneration: Menschen bilden auf Basis ihrer Erfahrungen mit bestimmten Medieninhalten und Medientechnologien bestimmte Handlungsstile aus, die sich in Medienpraxiskulturen verdichten (Schäffer & Schorb, 2009).
Dennoch – Jüngere nutzen Smartphone und Co. viel intensiver und selbstverständlicher als Ältere (Valkenburg & Peter, 2011), wie auch aktuelle Zahlen zeigen: Während laut Statistik Austria (2017) beinahe alle 16 bis 24 jährigen ÖsterreicherInnen (92 %) das Smartphone nutzen, um auf soziale Netzwerkplattformen zuzugreifen, sind es bei den 45 – 54 Jährigen nur weniger als die Hälfte (44 %).
Digitale Medientechnologien unterstützen junge Menschen bei der Erfüllung von Grundbedürfnissen wie jenem der sozialen Anerkennung und Einbettung (Taylor 1997, S. 15). Die online Sphäre ist dabei nicht mehr von der „realen Welt“ zu trennen, denn Heranwachsende und junge Erwachsene sind „always on“ (Hepp, 2014a; Würfel & Keilhauer, 2009): Wie wichtig die unmittelbare Verbundenheit ist, zeigt sich daran, dass der Instant Messenger WhatsApp bei österreichischen Jugendlichen zwischen elf und 17 Jahren laut Jugend-Internet-Monitor (2017)1 das meistgenutzte (93 %) und als am wichtigsten eingeschätzte (77 %) soziale Netzwerk ist.
Distanzierte Verbundenheit oder Zwang zur Dauerkommunikation?
Digitale Medien- und Informationstechnologien ermöglichen es uns, permanent mit anderen verbunden und ständig up-to-date zu sein, was in unserem engeren, aber auch weiteren sozialen Umfeld passiert. Heranwachsende orientieren sich was ihre Leitwerte und Lebensstile betrifft, vor allem an ihren Peer-groups. In Zeiten des Web 2.0 hat sich diese Peer-group Orientierung stark ins Internet verlagert – Social Media können damit als Super-Peers bezeichnet werden. Zu wissen, was dort vor sich geht, ist entscheidend für die soziale Integration. Umso größer ist die Angst etwas zu versäumen.
FOMO (Fear of missing out) treibt viele NutzerInnen dazu, ständig die Benachrichtigungen auf ihren Smartphones, die neuesten Bilder auf Instagram und den Facebookstatus ihrer FreundInnen zu checken.
Immer auf dem Laufenden sein zu müssen, was im digitalen Umfeld passiert, kann auch zwanghaft werden. Denn mittlerweile ist die Smartphone Nutzung zu einem unbewussten Reflex geworden: Laut einer Studie der Universität (Markowetz, 2015), bei der die Daten von 60.000 Smartphone NutzerInnen ausgewertet wurden, griffen die TeilnehmerInnen im Schnitt 88-mal am Tag nach ihrem Gerät. Davon entsperrten sie es 53-mal, um auf eine App zuzugreifen.
Zudem ist durch die mobile Verfügbarkeit sämtlicher Informations- und Kommunikationsdienste auch der Erreichbarkeitsdruck speziell bei den Heranwachsenden gestiegen. Präsenz bedeutet nicht mehr nur physisch anwesend, sondern permanent erreichbar und antwortbereit zu sein, was neue Aufmerksamkeitsregime entstehen lässt.
Wer kennt die Situation nicht? Mehrere Personen sitzen beisammen und starren auf ihr Smartphone, interagieren mit „abwesenden Anwesenden“. Häufig überlagern sich somit (ko-)präsente Interaktionssysteme mit medial konstruierten Vergegenwärtigungsformen. Dieses Multitasking kann durchaus zu Konflikten führen, wie folgender Auszug aus einer Gruppendiskussion mit 20 – 25-jährigen TeilnehmerInnen veranschaulicht:
Anna: „Ich finde es nervig, dass, wenn ich mit irgendwem irgendwo bin, dann ständig irgendein blödes Gerät vibriert und jeder offensichtlich diesen Druck verspürt, das sofort abzurufen und sofort zurück zu schreiben und das ist eigentlich weniger für die Person selbst ein Problem, die das macht, sondern eher für alle anderen, die drum herum sind und das gilt sowohl fürs Arbeitsleben, wie auch fürs Privatleben, dass einen das ständig aus dem Konzept wirft.
Leonie: „Stimmt, das nervt halt auch einfach, wobei ich auch, ehrlich gesagt, genau dasselbe mache.
Zeit und Aufmerksamkeit als knappe Güter
Junge Menschen navigieren heute von einem kleinen Informationshappen zum nächsten. Besonders beliebt ist die Kommunikation mittels Bildern, welche komplexe Zusammenhänge schneller erfassbar machen und Emotionen und Stimmungen komprimiert vermitteln. Bereits seit einigen Jahren wenden sich Heranwachsende verstärkt sozialen Netzwerken mit Bild- und Videofokus zu, während die Popularität von Facebook sukzessive abnimmt, nicht zuletzt, weil sich hier vermehrt die Eltern- und Großelterngeneration aufhält. YouTube (90 %), Instagram (68 %) und Snapchat (65 %) sind bei österreichischen Jugendlichen nach WhatsApp (93 %) die beliebtesten sozialen Netzwerke (Jugend-Internet-Monitor 2017).
In unseren informationsdichten Umwelten ist Aufmerksamkeit zu einem raren Gut geworden und gilt als Währung in Social Media. Umso wichtiger ist es für junge Menschen, aufzufallen und das in einer Art und Weise, die bei anderen gut ankommt. Gekonnte Social Media Präsenz und Selbstinszenierung wird belohnt: Dabei gelten „Likes“ als Messlatte für Popularität und soziale Anerkennung. Die Generation „Selfie“ orientiert sich dabei vorrangig an marktförmigen Selbstinszenierungen, welche dem Mainstream entsprechen (Großegger 2016).
Insgesamt lässt sich mit Hayles (2007, S. 187) ein intergenerationaler Wandel von kognitiven Stilen feststellen: Hyperaufmerksamkeit („hyper attention“) ersetzt dabei tiefe Aufmerksamkeit („deep attention“), wobei erstere durch das schnelle Switchen zwischen Episoden kennzeichnet ist, letztere die längere Konzentration auf ein Objekt oder einen Kommunikationszusammenhang beschreibt.
Auch werden Zwischenzeiten meist mit medienbezogenen Tätigkeiten gefüllt. Langeweile
kann dadurch kaum entstehen. Hier lässt sich das Paradoxon erkennen, dass Jugendliche ihren
Alltag häufig als zu durchrationalisiert empfinden, jedoch gleichzeitig den Drang verspüren,
„leere Zeit“ medial zu „bewirtschaften“. (Grossegger 2014, S. 31) Diese Phänomene können auch als Symptome einer Gesellschaft betrachtet werden, in der Zeitoptimierung als Leitwert gilt. Jugendkulturelle Interpretationen halten der Erwachsenenwelt insofern einen Spiegel vor.
Das heißt nicht, dass Jugendliche automatisch Gefahr laufen, „digitales Burn out“ zu erleiden.
Vielmehr zeigt sich, dass sich auch neue Taktiken etablieren, um sich dem allgegenwärtigen Druck der Erreichbarkeit zu entziehen: So gilt es etwa als durchaus gängige Praxis, eine WhatsApp Nachricht nicht zu öffnen, um den Eindruck zu erwecken, diese nicht gelesen/gesehen zu haben.
Dennoch wird es immer schwieriger, sich dem ununterbrochenen Informations- und Kommunikationsstrom zu entziehen. Zentrale Fragen in diesem Zusammenhang sind: Wer kontrolliert wen? Wie sieht es mit der (digitalen) Selbstbestimmung aus? Inwieweit sind NutzerInnen in der Lage, die Vernetzungs- und Informationspotenziale im Sinne ihrer gesellschaftlichen Teilhabe zu nutzen?
Digital Literacy und Selbstbestimmung fördern
Bereits 2012 titelte die New York Times2 „Wasting Time is New Divide in Digital Era“.
Entscheidend ist, ob digitale Medien- und Informationstechnologien nur für das Zeittodschlagen, das Bekämpfen von Langeweile, zur Unterhaltung genutzt werden oder der Vernetzung, der Aneignung von Wissen und neuen Kompetenzen und dem kreativen Selbstausdruck dienen.
Denn die neue digitale Kluft, also die Spaltung zwischen jenen, die die Potenziale vernetzter Technologien für sich nutzen können und jenen, die das nicht können, ist heute nicht mehr ausschließlich eine Frage des (technischen) Zugangs. Vielmehr sind es die Kompetenzen, welche unter dem Konzept der „digital literacy“ zusammengefasst werden, die zukünftig über die gesellschaftliche Teilhabe entscheiden werden.
Es hat sich gezeigt, dass bildungsnahe Personengruppen das Internet facettenreicher und kreativer als bildungsferne Bevölkerungsteile nutzen (Livingstone & Helsper 2007, S. 684).
Die DIVSI U25 Studie (2015) unterstreicht, dass milieuspezifische Unterschiede, was die Souveränität und Sicherheit im Umgang mit dem Internet betrifft, weiter bestehen.
Die Vermittlung von „digital literacy“ im Sinne eines umfassenden Konzeptes, das sowohl technologiebezogene, soziale und kreative Komponente, sowie den bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Informationen umfasst, muss daher ein zentrales Anliegen der Arbeit mit Heranwachsenden darstellen.